Die Malerin Bärbel Bohley wohnt seit vielen Jahren am Teutoburger Platz – mit einer Unterbrechung von mehr als einem Jahrzehnt. Ab 1996 arbeitete sie für Friedensprojekte in Bosnien, erst im vergangenen Jahr kehrte sie aus dem ehemaligen Jugoslawien an den Teute zurück. In einem Interview der Süddeutschen Zeitung beschreibt Bohley ihre Eindrücke vom Kiez nach den Jahren der Abwesenheit:
Süddeutsche Zeitung: Frau Bohley, wir treffen uns in Ihrer alten Wohnung in der Fehrbelliner Straße in Prenzlauer Berg. Sie waren 12 Jahre weg. Wie ist das Wiederkommen?
Bärbel Bohley: Als ich zurückkam hier in mein Viertel, da war ich verwirrt. Mein Lebensraum war in den letzten zwölf Jahren vorwiegend auf dem Balkan. In dieser Zeit hat sich hier viel verändert. Mein Haus wurde um 1860 gebaut, mit Außentoilette, Schwein auf dem Hof und einem Stall. Ich lebe in einem ehemaligen Arbeiterbezirk: Früher gab es hier in den Wohnungen keine Flügeltüren oder Parkett. Die sind aufgemotzt und verkleidet worden. Ich trauere nicht kaputten Fassaden hinterher. Aber dem verschwundenen Lebensgefühl.
Süddeutsche Zeitung: Den verschwundenen Menschen?
Bärbel Bohley: Ja. Mir fehlt unser alter Klempner. Die Frau, die die Tauben gefüttert hat. Oder meine Verkäuferin. Der Prenzlauer Berg war immer so eine soziale Mischung. Hier sah man Studenten mit Arbeitern oder Rentnern. Das war lebendig. Ich kannte fast alle meine Nachbarn. Jetzt sind sie mir fremd. Sie sagen „Hi“ statt „Guten Tag“. Manchmal komme ich mir vor, als würde ich in einem Theater leben.
Süddeutsche Zeitung: Bärbel Bohley über 1989
Wikipedia über Bärbel Bohley
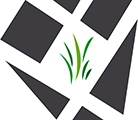
In der Reihe „Was macht?“ porträtiert die Berliner Zeitung heute Bärbel Bohley so: „In Berlin, im Prenzlauer Berg, fiel es ihr anfangs nicht leicht, sich wieder einzuleben. Ganze Viertel waren inzwischen aufwendig saniert worden, die Mieter fast komplett ausgewechselt. „Du siehst hier keine alten Leute mehr einkaufen gehen, nur noch Mütter Anfang vierzig, die ihr erstes Kind spazieren fahren. Jedes zweite Geschäft ist ein Bio-Laden, in dem sich die neue Schickeria trifft. Da möchte man schon aus Protest ein Schweineschnitzel aus Markkleeberg verlangen“, moserte sie. Sie dachte sogar daran, an den Stadtrand zu ziehen.“
Berliner Zeitung